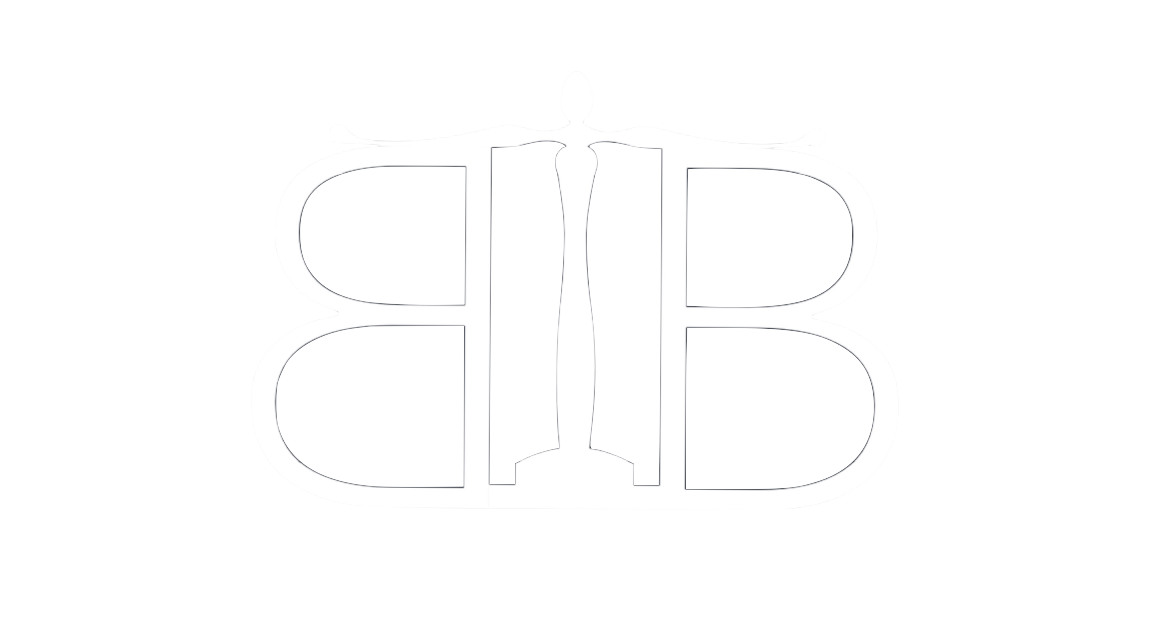Familienrecht
Das Familienrecht ist ein sehr emotionales und umfangreiches Rechtsgebiet.
Als Anwälte für Familienrecht betrauen uns Mandanten fast täglich mit Eheschließungen und Scheidungen.
Außerdem setzen wir auch Ihre Unterhalts- und Sorgerechtsansprüche durch.
Was umfasst das Familienrecht?
Das Familienrecht ist ein Teilgebiet des Zivilrechts und regelt die Rechtsverhältnisse zwischen den Familienangehörigen. Neben Ehesachen befasst sich das Familienrecht auch mit anderen Angelegenheiten, wie:
- Sorgerechtsansprüchen
- Unterhaltsverpflichtungen
- Vormundschaften
- Betreuung
Damit regelt das Familienrecht weit mehr als die Ehe beziehungsweise Partnerschaft zwischen zwei Personen. Das Familienrecht deckt ebenso die Rechtsbeziehungen sowie Ansprüche und Pflichten gegenüber anderen Verwandten ab.
In unserer Kanzlei haben wir uns insbesondere auf Eheschließungen, Scheidungen und die daraus resultierenden Fragen spezialisiert. Ebenso verfassen wir individuelle Eheverträge und bestimmen den für Sie passenden Güterstand. Bei einer Scheidung hingegen geht es meist um Besitzansprüche, Teilung des gemeinsamen Vermögens und das Sorgerecht für mögliche Kinder.
Eheschließung
Im Rahmen der Eheschließung muss das Paar entscheiden, ob es in einer Zugewinngemeinschaft oder einer Gütertrennung leben wird. Wir helfen bei der Auswahl des für Sie passenden Güterstands und klären Sie über die Vor- und Nachteile auf. Der Güterstand kann übrigens auch nach der Eheschließung angepasst werden – sprechen Sie uns einfach an!
Ehevertrag
Der Ehevertrag ist ein gutes Mittel, um für den Fall einer Trennung vorzusorgen. So können Sie bereits im Voraus das Sorgerecht, den Trennungsunterhalt und einen eventuellen Zugewinnausgleich im Scheidungsfall thematisieren. Selbstverständlich beraten wir Sie auch hinsichtlich steuerlicher Vor- und Nachteile bei Abschluss eines Ehevertrags.
Trennung/Scheidung
Kommt es zu einer Trennung oder Scheidung, ohne dass ein Ehevertrag besteht, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dieses regelt den Zugewinnausgleich, den Versorgungsausgleich und die Höhe des Trennungsunterhalts.
Sorgerecht/Aufenthaltsbestimmungsrecht
Kinder machen eine Scheidung oft komplizierter und noch emotionaler, als sie ohnehin ist. Wenn Sie sich jedoch bereits zu Anfang mit einem versierten Juristen verständigen, kann dieser viele Zweifel und Unklarheiten im Vorfeld aus dem Weg räumen. Sie wollen nur das Beste für Ihr Kind – wir setzen es für Sie um!
Unterhaltsverpflichtungen
Idealerweise wurden die Unterhaltsverpflichtungen beider Parteien bereits bei der Eheschließung im Rahmen eines Ehevertrags festgehalten. Andernfalls beraten wir Sie gern hinsichtlich Ihrer gesetzlichen Unterhaltsansprüche. Dabei steht nicht nur dem gemeinsamen Nachwuchs, sondern auch dem Ehepartner in der Regel ein Unterhalt zu. Die Höhe dieses Unterhalts und die Dauer richten sich dabei nach folgenden Kriterien:
- Vermögen der Parteien vor der Eheschließung
- Einkommen der Parteien während der Ehe
- Aufgabenteilung während der Ehe
- Einkommen und Vermögen der Parteien nach der Scheidung
- Kinder und deren Verwandtschaftsgrad zu den Parteien
Während die Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem Ehepartner nach einer bestimmten Zeit ausläuft, muss der Unterhalt für das Kind stets gesichert sein. Bis zur Volljährigkeit hat die Partei, bei der die Kinder wohnen, einen Anspruch auf Alimentenzahlungen seitens der Gegenpartei. Danach ist die finanzielle Zuwendung abhängig vom eingeschlagenen Arbeits- beziehungsweise Bildungsweg des Nachwuchses.
Begriffserklärung zum Thema Familienrecht
Aufenthaltsbestimmungsrecht
Was ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht?
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist ein Teil der elterlichen Sorge und regelt, bei welchem Elternteil das Kind lebt und wo es sich gewöhnlich aufhält. Es umfasst die Entscheidungsbefugnis über den Wohnort und den Aufenthalt des Kindes.
Beide Elternteile haben grundsätzlich das Recht, über den Aufenthaltsort ihres Kindes zu bestimmen. Nach der Trennung der Eltern kann es beim gemeinsamen Sorgerecht für das eigene Kind bleiben. Konflikte können allerdings eine Auseinandersetzung vor dem Familiengericht unvermeidbar machen. Dies gilt vor allem, wenn ein Umzug in eine weiter entfernte Regionen oder das Ausland im Raum steht.
Gern beraten wir Sie in unserer Kanzlei über Ihre Möglichkeiten, das Aufenthaltsbestimmungsrecht durchzusetzen. Als Anwalt für Familienrecht stehen wir Ihnen auch bei Fragen zur Scheidung sowie Unterhaltsansprüchen zur Seite.
Was umfasst das Aufenthaltsbestimmungsrecht?
Das elterliche Sorgerecht besteht aus der Personensorge und der Vermögenssorge. Die Personensorge umfasst auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht, d.h. das Recht der/des Sorgeberechtigten, den Wohnort und die Wohnung des minderjährigen Kindes zu bestimmen.
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht umfasst folgende Bereiche:
die Bestimmung des Wohnorts
Zeiten und Orte, zu denen Besuche stattfinden dürfen
Urlaubsplanungen
die Wahl der Schule
Generell sollte dabei stets das Kindeswohl im Fokus stehen.
Die Personensorge umfasst auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht, d.h. das Recht der/des Sorgeberechtigten, den Wohnort und die Wohnung des Kindes zu bestimmen.
Rechtliche Grundlagen des Aufenthaltsbestimmungsrechts
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Hier sind die wesentlichen Bestimmungen zu finden:
§ 1626 BGB: Elterliche Sorge, Grundsätze
§ 1671 BGB: Übertragung der elterlichen Sorge bei Getrenntleben
§ 1687 BGB: Ausübung der gemeinsamen Sorge bei Getrenntleben
Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht trennen
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht kann von der Personensorge abgetrennt werden, wenn dies dem Kindeswohl am besten entspricht. Dabei kann es im Übrigen bei der bisherigen Sorgerechtsregelung bleiben, d.h. das Aufenthaltsbestimmungsrecht kann auch bei im Übrigen gemeinsamem Sorgerecht auf einen Elternteil übertragen werden.
Die Abspaltung des Aufenthaltsbestimmungsrechts kommt insbesondere in Betracht, wenn die Gefahr besteht, dass ein Elternteil das Kind unberechtigt in das Ausland bringt oder der sorgeberechtigte Elternteil die Herausgabe des Kindes zur Ausführung des Umgangsrechts des Kindes verweigert.
Umzug ins Ausland: Ein Grund für eine strafrechtliche Verfolgung?
Wechselt ein Elternteil, der das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind hat, seinen Wohnort und den des Kindes innerhalb der Staaten der Europäischen Gemeinschaft gegen den Willen des im Übrigen mitsorgeberechtigten Elternteils, ist das nicht widerrechtlich im Sinne von Art. 3 der Haager Kindesentführungsübereinkommen, weil der andere Elternteil seine Mitsorge auch von seinem Heimatland aus in ausreichendem Maße ausüben kann.
Anders kann die Entscheidung des Gerichts aussehen, wenn die Verbringung in einen Staat außerhalb der EU geplant ist.
Direkte oder nachträgliche Abspaltung des Aufenthaltsbestimmungsrechts
Die Entscheidung über eine Abspaltung des Aufenthaltsbestimmungsrechts kann mit der erstmaligen Sorgerechtsentscheidung ergehen oder eine Sorgerechtsentscheidung nachträglich abändern.
Im Verfahren über die einstweilige Anordnung zur Aufenthaltsbestimmung ist das Kind vorerst in seinem bisherigen sozialen Umfeld zu belassen. Voraussetzung ist aber, dass der Ausgang des Hauptverfahrens offen ist.
Achtung: Das Aufenthaltsbestimmungsrecht kann auch auf einen Pfleger übertragen werden.
Wann wird das Aufenthaltsbestimmungsrecht relevant?
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht wird besonders relevant in den folgenden Situationen.
Trennung oder Scheidung: Wenn sich Eltern trennen, muss entschieden werden, bei wem das Kind hauptsächlich leben soll.
Umzug: Wenn ein Elternteil umziehen möchte, kann dies Auswirkungen auf das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben.
Streitigkeiten zwischen Eltern: Bei Uneinigkeit der Eltern kann das Familiengericht eine Entscheidung treffen.
Ist es möglich, das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht einzuklagen?
Ja, grundsätzlich kann jeder Elternteil neben dem Sorgerecht auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragen. Zuständig ist das Familiengericht.
Die Voraussetzungen sind allerdings streng. Grundsätzlich besteht das Ziel des Gerichts darin, beiden Elternteilen die Entscheidung zu übertragen.
Es kann allerdings berechtigte Gründe geben, die den Entzug rechtfertigen. Dies gilt beispielsweise bei einem geplanten Umzug ins Ausland. Das Gericht rückt dabei das Kindeswohl ins Zentrum der Überlegungen.
Wie sind außergerichtliche Einigungen möglich?
Um ein gerichtliches Verfahren zu vermeiden, können Sie versuchen, sich selbst zu einigen. Sie können auch die Hilfe des Jugendamts in Anspruch nehmen, um rechtliche Regeln auszuarbeiten.
Gern beraten wir Sie, um das beste Ergebnis für Sie und Ihr Kind zu erreichen.
Ändert eine Regelung des Aufenthaltsbestimmungsrechts das Umgangsrecht?
Nein, das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist unabhängig vom Umgangsrecht. Hat ein Elternteil das Aufenthaltsbestimmungsrecht inne, so hat der andere Elternteil nach wie vor ein Besuchsrecht. Dabei ist eine vorübergehende Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts möglich.
Fazit
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Kinder ist ein zentraler Aspekt der elterlichen Sorge, der bei Trennungen und Umzügen eine wichtige Rolle spielt. Eltern sollten stets das Wohl des Kindes im Blick haben und bei Unstimmigkeiten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Eine klare Regelung des Aufenthaltsbestimmungsrechts trägt maßgeblich zur Stabilität und dem Wohlbefinden des Kindes bei.
Düsseldorfer Tabelle
Bei der Düsseldorfer Tabelle handelt es sich um eine von den Familiensenaten der Oberlandesgerichte entwickelte und geführte Tabelle zur Vorgabe von Leitsätzen bei Unterhalt. Dabei bestehen Vorgaben für folgende Unterhaltsbereiche:
- Kindesunterhalt
- Ehegattenunterhalt
- Mangelfälle
- Unterhalt bei nicht miteinander verheirateten Eltern
Zusätzlich werden Mangelfälle genannt, bei denen es nicht möglich ist, Unterhalt zu zahlen.
Die Düsseldorfer Tabelle als einheitliche Vorgabe im gesamten Bundesgebiet
Die Regelsätze der Düsseldorfer Tabelle sind bundeseinheitlich anerkannt und werden alle zwei Jahre neu berechnet. Seit dem 01.01.2008 gelten die Grundsätze für das gesamte Bundesgebiet - die zuvor für das Gebiet der neuen Bundesländer entwickelte Berliner Tabelle ist nicht mehr anwendbar.
Die Unterhaltswerte der Düsseldorfer Tabelle sind zu unterscheiden von dem gesetzlichen Mindestunterhalt, der ausgehend vom Bedarf des Kindes lediglich die untere Grenze für Unterhaltszahlungen festlegt.
Zum 01.01.2010 wurden die Unterhaltssätze um durchschnittlich 13 % angehoben.
Die Düsseldorfer Tabelle ist auf der Internetseite des OLG Düsseldorf einsehbar. In Hessen gelten die gleichen Tabellen. Es finden aber die Leitlinien des Oberlandesgerichts Frankfurt Anwendung..
In Hessen gelten die gleichen Tabellen. Es finden aber die Leitlinien des Oberlandesgerichts Frankfurt Anwendung.
Berechnung des Unterhalts – eine komplexe Aufgabe
Der Unterhaltsbedarf orientiert sich an den zur Verfügung stehenden Mitteln. Bei einkommensstarken Elternteilen zahlen Unterhaltspflichtige mehr Geld als in einkommensschwachen Familien.
Gemäß der Düsseldorfer Tabelle wird dabei stets das Netto-Einkommen des Unterhaltspflichtigen berücksichtigt. Die Werte erhöhen sich mit steigendem Einkommen, jedoch fällt auch der Betrag, der dem Unterhaltspflichtigen verbleiben muss, höher aus.
Kindesunterhalt hat Vorrang
Unter den Unterhaltsformen hat der Kindesunterhalt den höchsten Stellenwert. Erst wenn dieser gedeckt ist, kommen Ehegattenunterhalt sowie der Unterhalt nicht verheirateter Eltern in Betracht.
Die Höhe des Unterhalts für Kinder richtet sich nicht nur nach den Einkommensverhältnissen, sondern auch nach dem Alter der Kinder. Für minderjährige Kinder gelten demnach geringere Regelsätze als für erwachsene Kinder.
Die Düsseldorfer Tabelle unterscheidet folgende Altersstufen:
- 0 bis 5 Jahre
- 6 bis 11 Jahre
- 12 bis 17 Jahre
- 18 Jahre und darüber
Arbeiten Kinder mit 18 Jahren bereits und sind von zu Hause ausgezogen, kann der Unterhalt entfallen. Bei der Aufnahme eines Studiums besteht die Unterhaltsverpflichtung hingegen während der gesamten Studiendauer.
Achtung: Nach einer Scheidung sind beide Elternteile einem allein wohnenden erwachsenen Kind in der Ausbildung unterhaltspflichtig.
Ehegattenunterhalt
Der Ehegattenunterhalt gilt während der Trennung, bevor eine Scheidung erfolgt. Der zu zahlende Betrag liegt nach der Düsseldorfer Tabelle bei 45 % des anrechenbaren Einkommens. Es gibt jedoch diverse Abzugsposten, die den Ehegattenunterhalt verringern können.
Arbeiten beide Ehepartner, wird der Unterhalt anhand der Einkommensdifferenz ermittelt. Gern beraten wir Sie in dieser Konstellation sowie bei weiteren Fragen zum Familienrecht.
Unterhalt bei nicht miteinander verheirateten Eltern
Der Unterhalt dieses Bereichs ist gem. § 1615l Abs. 2 BGB auf 3 Jahre begrenzt. Die Unterhaltszahlung erfolgt, wenn die Kindererziehung der Aufnahme der Erwerbstätigkeit entgegensteht.
Der zu zahlende Betrag kann sehr hoch ausfallen. Es gelten allerdings höhere Grenzen des Selbstbehalts.
Mangelfälle: Was passiert, wenn der Unterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle nicht gezahlt werden kann?
Die Rechtsprechung ist darauf ausgerichtet, den minimalen Kindesunterhalt sicherzustellen. Bei einem niedrigen eigenen Einkommen oder anderweitigen Schulden kann die Leistungsfähigkeit jedoch begrenzt sein.
Der Bedarfskontrollbetrag, der in der Düsseldorfer Tabelle angegeben wird, kann je nach Wohnort und sonstigen Lebensumständen anders beurteilt werden.
Zögern Sie nicht, sich bei der Durchsetzung oder Zahlung von Unterhaltsansprüchen an uns zu wenden. Wir sind für Sie da und helfen Ihnen, Ihr Recht durchzusetzen.
Ehevertrag
Eheverträge sind Verträge, durch die Eheleute eine Regelung ihrer güterrechtlichen Verhältnisse treffen wollen:
Es wird ein anderer als der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft vereinbart.
Die Zugewinngemeinschaft wird modifiziert.
Der Versorgungsausgleich wird ausgeschlossen.
Ein Ehevertrag erfordert immer eine notarielle Beurkundung.
Unzulässig sind grundsätzlich Vereinbarungen, nach denen eine Scheidung ausgeschlossen oder erschwert werden soll, z.B. durch die Zahlung eines Geldbetrages für den Fall der Scheidungseinreichung. Derartige Vereinbarungen sind aber wirksam, wenn ihnen ein anderer Zweck zugrunde liegt, z.B. die finanzielle Absicherung des Ehepartners. Dies ist gegebenenfalls durch Auslegung zu ermitteln.
Vereinbarungen über die Ausübung der elterlichen Sorge bzw. des Umgangsrechts können vertraglich zwischen den Eltern geregelt werden. Auch kann bei dem Bestehen der gemeinsamen elterlichen Sorge ein Teil des Sorgerechts aufgrund einer Vereinbarung nur einem Elternteil zustehen. Unwirksam (da sittenwidrig) sind jedoch Vereinbarungen, nach denen bei gleichzeitiger finanzieller Vergünstigung auf das Sorgerecht oder das Umgangsrecht verzichtet wird.
Insbesondere Vereinbarungen über den Unterhalt im Rahmen eines Ehevertrages unterliegen der richterlichen Kontrolle.
Der Bundesgerichtshof hatte in der durch die Medien viel beachteten Entscheidung über eine Inhaltskontrolle von Eheverträgen zu entscheiden (BGH 11.02.2004 - XII ZR 265/02):
Danach steht es den Eheleuten grundsätzlich frei, die gesetzlichen Regelungen über den Zugewinn, den Versorgungsausgleich und den nachehelichen Unterhalt ehevertraglich auszuschließen. Es besteht kein unverzichtbarer Mindestgehalt an Scheidungsfolgen zugunsten des berechtigten Ehegatten.
Eine Grenze ist da zu ziehen, wo die vereinbarte Lastenverteilung der individuellen Gestaltung der Lebensverhältnisse nicht mehr gerecht wird. Dies ist insbesondere bei einer einseitigen Benachteiligung eines Ehepartners der Fall.
Eine einseitige Benachteiligung liegt umso eher vor, als dass in den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts eingegriffen wird. Dazu gehört in erster Linie der Unterhalt wegen Kindesbetreuung und in zweiter Linie der Alters- und Krankheitsunterhalt. Auch der Versorgungsausgleich kann bei Vorliegen dieser Voraussetzungen nicht uneingeschränkt ausgeschlossen werden.
Vereinbarungen über den gänzlichen oder den teilweisen Ausschluss des Zugewinnausgleichs sind hingegen grundsätzlich unbeschränkt wirksam.
Zugewinnausgleich
Der Zugewinnausgleich ist ein bei im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebenden Ehegatten im Falle der Beendigung des Güterstandes durchzuführender Vermögensausgleich. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass innerhalb einer Ehe die Eheleute an Vermögen dazugewonnen haben. Dieser Vermögenszwachs steht beiden Eheleuten gleichermaßen zu. Am Ende einer Ehe wird er durch den Zugewinnausgleich eine Verteilung dieses Vermögenszuwachses durchgeführt.
Zur Berechnung des Zugewinnausgleichs wird der Vermögenszuwachs, den jeder einzelne Ehegatte vom Beginn bis zum Ende der Ehe erzielt hat, verglichen. Der Ehegatte, der den höheren Zuwachs erzielt hat, muss die Hälfte der Differenz der beiden Vermögenswerte an den anderen auszahlen.
Das Anfangsvermögen muss mithilfe des Lebenshaltungsindexes auf die zurzeit maßgeblichen Werte umgerechnet werden. Sofern es nur durch die Geldentwertung zu einer Wertsteigerung des Anfangsvermögens gekommen ist, findet kein Zugewinnausgleich statt.
Gemäß § 1374 Abs. 1 BGB werden Verbindlichkeiten zu Beginn der Ehe für die Berechnung berücksichtigt, d.h. sofern entsprechend hohe Verbindlichkeiten bestehen, ist ein negatives Anfangsvermögen möglich.
Auch bei der Berechnung des Endvermögens sind Verbindlichkeiten von dem positiven Vermögen abzuziehen.
Bei dem ausgleichberechtigten Ehegatten besteht nach der Durchführung des Zugewinnausgleichs bezüglich der ihm zustehenden Forderung eine Kappungsgrenze:
Die Höhe der Ausgleichsforderung wird durch den hälftigen Wert des Vermögens des ausgleichspflichtigen Ehegatten begrenzt, das nach Abzug der Verbindlichkeiten bei Beendigung des Güterstandes vorhanden ist.
Wenn eine Ehe gescheitert ist und das Scheidungsverfahren ansteht, muss festgestellt werden, ob für die Ehepartner ein Zugewinnausgleich abgewickelt werden muss oder ob es einen Ehevertrag mit eigenen Regelungen gibt oder ein anderer Güterstand relevant ist. Gibt es keinen Ehevertrag, dann lebt das Ehepaar automatisch in einer Zugewinngemeinschaft. In diesem Fall kann der Ehepartner, der während der Ehe weniger verdient hat, einen Zugewinnausgleich beanspruchen, sodass der Ehegatte, der während der Ehezeit mehr verdient hat, die Hälfte seines ehelichen Zugewinns an den anderen Ehepartner abgeben muss.
Für die Ermittlung eines Zugewinnausgleichs, ist eine Vermögensaufstellung des Ehepaares notwendig, wobei hierbei das komplette Vermögen berücksichtigt wird.
Sollte ein Ehegatte kein Vermögen, sondern mehr Schulden bei der Scheidung haben als bei der Schließung der Ehe, setzt man den Zugewinn mit Null an.
Wie eine Zugewinngemeinschaft nach Beendigung abgewickelt wird und wann ein Zugewinnausgleich nicht durchgeführt wird, erläutern wir Ihnen im nachfolgenden Text.
Die Scheidung und die Ermittlung des Zugewinnausgleichs
Im Rahmen eines Zugewinnausgleichs wird das Vermögen jedes Ehepartners bei der Eheschließung mit dem aktuellen Endvermögen verglichen. Entscheidend für diese Ermittlung ist nicht das Datum der Scheidung, sondern der Tag, an dem der andere Ehegatte postalisch den Scheidungsantrag erhalten hat.
Beispiel
Herr Müller hat bei der Eheschließung 30.000 Euro und zum Zeitpunkt der Scheidung ein Endvermögen von 60.000 Euro. Die Ehefrau hatte 4.000 Euro bei der Eheschließung und bei der Scheidung 7.000 Euro.
Der Zugewinn des Ehemanns errechnet sich wie folgt beim Ehemann: 60.000 Euro minus 30.000 Euro sind 30.000 Euro, bei der Ehefrau: 7.000 Euro minus 4.000 Euro sind 3.000 Euro
Der Überschuss an Zugewinn beträgt in diesem Fall 30.000 Euro minus 3.000 Euro, also 27.000 Euro und die Ehefrau bekommt demnach die Hälfte – also 13.500 Euro.
In Folge dessen ist es bei einer Scheidung für einen Ehepartner von Vorteil, wenn sein Anfangsvermögen größer ist als das Endvermögen, da der Zugewinn dann geringer ist.
Wann in einer Zugewinngemeinschaft kein Ausgleich durchgeführt wird
In ganz bestimmten Konstellationen einer Scheidung kann es passieren, dass kein Zugewinnausgleich durchgeführt wird.
Kein Antrag gestellt – Es bleibt jedem Ehepartner selbst überlassen, ob er in seiner Zugewinngemeinschaft und im Rahmen der Scheidung seinen Anspruch geltend machen möchte. Wer bei der Scheidung keinen Antrag für einen Zugewinnausgleich stellt, bekommt keinen Ausgleich.
Gleichwertiger Zugewinn – Sollten beide Ehepartner während der Ehe gleich viel Vermögen erwirtschaftet haben, dann muss auch kein Ausgleich berechnet und durchgeführt werden. Beispiel: Bei der Eheschließung besaß das Ehepaar kein Vermögen, sie haben aber während der Ehe ein gemeinsames Haus erworben. Weitere Vermögen sind nicht vorhanden. In dieser Konstellation ist der Zugewinn des Ehepaares gleich groß – denn sie haben jeder das halbe Miteigentum am Haus. Diese Konstellation macht einen Zugewinnausgleich nicht notwendig.
Vertrag – Die Ehepartner können gemeinsam in einem Ehevertrag eine Vereinbarung treffen, dass der Zugewinnausgleich nicht vorgenommen wird oder dass er anders berechnet werden soll. Sie können beispielsweise auch vereinbaren, dass bestimmte Vermögensgegenstände unberücksichtigt bleiben sollen. Oder sie bestimmen, dass der berechtigte Ehepartner eine Pauschalsumme als Abfindung erhält. Diese Vereinbarungen werden allerdings nur wirksam, wenn sie notariell beglaubigt sind.
Zugewinngemeinschaft
Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung oder Gütergemeinschaft sind Güterstände in Deutschland. Mit dem Güterstand regelt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) die Zuordnung von Vermögenswerten und Schulden eines Ehepaares. Entscheiden sich die Ehepartner nicht per notariell beglaubigtem Ehevertrag anders, gilt nach der Heirat der gesetzliche oder Regelgüterstand, die Zugewinngemeinschaft.
Anders als der Begriff vermuten lässt, entsteht bei der Zugewinngemeinschaft (§ 1363 BGB) keine gemeinsame Kasse, in die mitgebrachtes oder in der Ehe erwirtschaftetes Vermögen beider Partner fließt. Vielmehr leben diese weiterhin wie in einer Gütertrennung und erwirtschaften ihr eigenes Vermögen.
Steht eine Trennung an, wird der erzielte Zugewinn auf Antrag ausgeglichen. Das erfolgt im Rahmen der Scheidung, eines Todesfalls oder aufgrund einer vertraglichen Regelung.
Wer haftet in der Zugewinngemeinschaft für Schulden?
Bei der Zugewinngemeinschaft haftet jeder Partner allein für seine Schulden. Dabei ist es unerheblich, ob diese vor oder während der Ehe entstanden sind.
Was ändert sich durch die Zugewinngemeinschaft?
Der gesetzliche Güterstand sieht einige Besonderheiten für beide Ehepartner vor:
Verfügung über das eigene Vermögen
Zwar darf jeder über seine eingebrachten oder erwirtschafteten Vermögenswerte verfügen, das gilt jedoch nicht für das Vermögen im Ganzen. Möchte einer der Partner über ca. 85 % seines Vermögens oder mehr verfügen, muss der andere Partner zustimmen. Das kann beispielsweise bei Veräußerung einer Immobilie eintreten.
Die Schwelle ist jedoch derart hoch, dass fast alle Gegenstände selbst veräußert werden dürfen. Bei einer Immobilie ist dies allein schon deshalb selten der Fall, da sie oftmals beiden Ehepartnern gemeinsam gehört. Eine Verfügung würde somit auch direkt in die individuellen Vermögensrechte des anderen Ehepartners eingreifen.
Verfügung über Haushaltsgegenstände
Sie wollen Haushaltsgegenstände verschenken, verkaufen oder verpfänden? § 1369 BGB fordert für Sachen, die der gemeinsamen Lebensführung dienen, die Zustimmung des Ehepartners. Darunter versteht das BGB alle Dinge im Haushalt, die gemeinsam genutzt werden, auch wenn sie einem Partner gehören. Das umfasst u. a. Haushaltsgeräte, Fernseher, Möbel, Fahrzeuge. Auch Tiere gehören dazu, wenn sie nicht nur einem Partner gehören.
Kann ein Gerichtsbeschluss die Zustimmung des Partners ersetzen?
Ist der zustimmungspflichtige Partner krank oder länger abwesend, kann das Familiengericht dessen Einverständniserklärung ersetzen. Die Zustimmung ist auch dann ersetzbar, wenn der Partner sie ohne ausreichende Gründe ablehnt.
Was zählt zum Zugewinn in der Ehe?
Der Zugewinn in der Ehe beschreibt den Teil des Vermögens, der verbleibt, wenn Sie das Anfangsvermögen vom Endvermögen abziehen. Nehmen wir in einem einfachen Beispiel an, A besitzt zu Beginn der Ehe 10.000 Euro und B 100.000 Euro.
Zum Ende der gemeinsamen Ehezeit beträgt das gesamte Vermögen 150.000 Euro. In diesem Fall beläuft sich der Zuwachs auf 40.000 Euro (150.000 Euro minus 110.000 Euro). Der Zuwachs von 40.000 Euro wird zwischen beiden Ehepartnern in einem Scheidungsverfahren hälftig aufgeteilt. Derjenige, auf dessen Konto sich das Geld befindet, muss dem anderen das entsprechende Kapital auszahlen. Angenommen, in diesem Fall befindet sich das gesamte zusätzliche Vermögen auf dem Konto von A, müsste dieser nun 20.000 Euro an B zahlen.
Bitte beachten Sie, dass der Zugewinn jedes einzelnen Partners für sich gewertet wird. In der Ehe kann jeder Partner so eigenes Vermögen anhäufen und auch frei darüber verfügen. Erst im Rahmen des Zugewinnausgleichs werden die beiden individuellen Wertzuwächse zusammengerechnet und anschließend aufgeteilt. Das obige Beispiel stellt daher eine Vereinfachung der rechtlichen Praxis dar.
Vermögenswerte, die zum Zugewinn in der Ehe zählen
Der Zugewinn in der Ehe umfasst nahezu alle Vermögenswerte, die während der Ehezeit angeschafft werden bzw. deren Wert sich erhöht.
Dazu zählen:
Geld auf Sparkonten sowie Bargeld
Selbst genutzte oder vermietete Immobilien sowie Grundstücke
Aktien, Wertpapiere, Fonds und auch Kryptowährungen
Schmuck und hochwertige Kleidungsstücke (beispielsweise Designer-Handtaschen, Designer-Schuhe)
Sammlungen (ganz gleich, ob es sich um Münzen, Briefmarken oder Spielfiguren handelt)
Fahrzeuge (Boote, Autos, Motorräder, Fahrräder etc.)
Rentenansprüche
Diese Liste soll Ihnen einen Überblick über den Umfang des zu teilenden Vermögens verschaffen. Es gibt allerdings noch viele weitere spezielle Vermögenswerte, die ebenfalls zum Zugewinnausgleich gerechnet werden.
Was ist vom Zugewinnausgleich ausgenommen?
Der Zugewinnausgleich bezieht sich grundsätzlich auf den gesamten Vermögenszuwachs während der Ehezeit. Ausnahmen gelten hingegen für Schenkungen an einen Ehepartner sowie Erbschaften, die in der Ehezeit anfallen.
Erbt ein Ehepartner beispielsweise eine Immobilie (mit einem Wert von 400.000 Euro) und ein Barvermögen von 50.000 Euro, werden beide Werte im Rahmen des Zugewinnausgleichs dem Anfangsvermögen hinzuaddiert. Der Partner wird so gestellt, als hätte das Erbe bereits vor der Eheschließung bestanden.
Endet die Ehe jedoch viele Jahre später, wirkt sich dies oft positiv auf den Wert der Immobilie aus. Ist die Immobilie zum Zeitpunkt der Scheidung 600.000 Euro wert und das Barvermögen ist durch eine clevere Wertanlage auf 100.000 Euro gestiegen, werden diese Zuwächse mitberücksichtigt.
Zum Zugewinn des Ehepartners zählen somit 250.000 Euro (600.000 Euro – 400.000 für die Immobilie sowie 100.000 Euro – 50.000 Euro für das Barvermögen).
Neben der Erbschaft kann auch eine Schenkung zu diesem Effekt führen. Allerdings muss dabei ein besonderes Verhältnis zwischen dem Schenkenden und einem der beiden Ehepartner bestehen. Dies ist beispielsweise im Erbrecht im Wege einer vorweggenommenen Erbfolge der Fall. Ein verwandtschaftliches Verhältnis ist allerdings nicht verpflichtend.
Wie berechnet sich der Zugewinnausgleich?
Der Gesetzgeber setzt voraus, dass in der Ehe unterschiedlich erwirtschaftetes Vermögen durch die Aufgabenverteilung (berufliche Tätigkeit, Haushalt, Kinder) entsteht. Der Ausgleich erfolgt nicht ohne Antrag. Nur wenn ein Partner den Zugewinnausgleich beispielsweise im Scheidungsverfahren anfordert, nimmt das Familiengericht dessen Berechnung vor:
Stichtag für die Berechnung ist der Tag, an dem der Scheidungsantrag dem Ehepartner zugestellt wird.
Das Familiengericht vergleicht das jeweilige Anfangsvermögen der Partner bei Heirat mit dem Endvermögen bei Scheidung.
Auch Wertsteigerungen von Vermögenswerten sowie Erbschaften, Schenkungen und Schulden finden Berücksichtigung.
50 % der ermittelten Differenz stehen dem Partner mit einem geringeren Vermögenszuwachs als steuerfreier Zugewinnausgleich zu.
Der Ausgleichsanspruch ist auf das Vermögen begrenzt, über das der zahlungspflichtige Partner nach der Scheidung verfügt.
Fragen Sie Ihren Anwalt für Familienrecht
Die Zugewinngemeinschaft birgt einiges an Streitpotenzial. Beteiligte zweifeln Anfangs- und Endvermögen oder die Bewertung von Vermögenswerten an, akzeptieren deren Zuordnung zu den Personen nicht oder bleiben den ermittelten Ausgleichsanspruch schuldig.
Als erfahrene Anwaltskanzlei für Familienrecht und weitere Rechtsgebiete in Friedberg unterstützen wir Sie gerne. Wir nehmen uns Zeit für Sie und geben Ihnen eine Ersteinschätzung — unvoreingenommen und diskret.
Scheidung
Mit dem Begriff "Scheidung" bezeichnet man die Auflösung der Ehe. Eine Ehe wird gemäß § 1565 BGB geschieden, wenn sie gescheitert ist.
Ausreichend ist es, wenn in dem Scheidungsverfahren ein Rechtsanwalt tätig ist. Voraussetzung ist dann aber, dass der Antragsgegner keine eigenen Anträge stellt.
Voraussetzungen der Scheidung sind:
Die eheliche Lebensgemeinschaft der Ehegatten besteht nicht mehr.
Es ist nicht zu erwarten, dass sie wiederhergestellt wird. Dabei genügt es, wenn aus dem Verhalten und den glaubhaften Bekundungen des die Scheidung beantragenden Ehegatten zu entnehmen ist, dass er unter keinen Umständen bereit ist, zu dem anderen Ehegatten zurückzufinden und die Ehe fortzusetzen. Eine Ehe gilt daher auch dann als zerrüttet, wenn nur ein Ehegatte sich endgültig abgewendet hat und die Ehe nur einseitig als zerrüttet angesehen wird, weil dann eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht mehr erwartet werden kann.
Die gesetzlich vorgesehenen Trennungszeiten wurden eingehalten: Die Eheleute leben seit mindestens einem Jahr getrennt und beide haben die Scheidung beantragt oder der Antragsgegner hat dem Antrag zugestimmt.
Nach dem Trennungsjahr findet notfalls eine streitige Scheidung statt, wenn ein Ehegatte der Scheidung widerspricht. In der Regel werden heute alle Ehen nach einjähriger Trennungszeit geschieden.
Der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags ist bedeutend für die Berechnung einiger Ansprüche, so z.B.:
Zugewinnausgleich
Versorgungsausgleich
Vorsorgeunterhalt
Sorgerecht
Unter Sorgerecht versteht man umgangssprachlich die elterliche Sorge. Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). Damit haben die Sorgeberechtigten – i.d. Regel die Eltern – die Pflicht, sich um das Kind und seine Belange verantwortungsvoll zu kümmern.
Bei der Trennung der Eltern bleibt das Sorgerecht grundsätzlich bei beiden Eltern. Nur auf Antrag eines Elternteils wird das Sorgerecht einem Elternteil zugewiesen.
Sind die Eltern nicht verheiratet, ist die Mutter nach der Geburt alleine sorgeberechtigt.
Ab dem 19.05.2013 gilt aber das neue Sorgerecht.
Es erleichtert dem unverheirateten Vater das Sorgerecht für sein Kind. Es soll im Interesse des Kindes grundsätzlich ein gemeinsames Sorgerecht geben. Der Vater erhält nur dann kein gemeinsames Sorgerecht, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Dies dürfte jedoch die absolute Ausnahme sein.
Um schnell Klarheit über die Sorgerechtsfrage zu erhalten, findet ein abgestuftes Verfahren statt:
- Erklärt die Mutter nicht ihr Einverständnis zur gemeinsamen Sorge, kann der Vater zunächst zum Jugendamt gehen, um doch noch eine Einigung mit der Mutter zu erreichen. Wenn der Vater diesen Weg für nicht erfolgversprechend hält, kann er auch gleich einen Sorgerechtsantrag beim Familiengericht stellen.
- Im gerichtlichen Verfahren erhält die Mutter Gelegenheit zur Stellungnahme zum Antrag des Vaters. Die Frist dafür endet frühestens sechs Wochen nach der Geburt. Durch diese 6-Wochen-Frist soll sichergestellt werden, dass die Mutter nicht noch unter dem Eindruck der Geburt eine Erklärung im gerichtlichen Verfahren abgeben muss.
- Gibt die Mutter keine Stellungnahme ab und werden dem Gericht auch auf sonstige Weise keine Gründe bekannt, die der gemeinsamen Sorge entgegenstehen, soll das Familiengericht in einem schriftlichen Verfahren, ohne Anhörung des Jugend- amts und ohne persönliche Anhörung der Eltern entscheiden.
- Eine umfassende gerichtliche Prüfung wird zukünftig nur bei einem Widerspruch der Mutter stattfinden, wenn erhebliche Gründe zum Schutz des Kindes von ihr vorgebracht werden. Die Trennung der Eltern ist aber kein erheblicher Grund.
- Das Familiengericht spricht dem Vater das gemeinsame Sorgerecht zu, wenn die Übertragung dem Kindeswohl nicht entgegensteht (negative Kindeswohlprüfung).
- Nunmehr kann auch ein nicht verheirateter Vater beantragen, dass ihm die alleinige Sorge für das gemeinsame Kind übertragen wird, wenn er dafür Gründe im Kindeswohlinteresse vorträgt. Dies wird dann der Fall sein, wenn ein gemeinsames Sorgercht nicht in Betracht kommt und zu erwarten ist, dass die Übertragung auf den Vater dem Wohl des Kindes am besten entspricht.
Trennung
Die Trennung
Wenn Ehepartner sich entschließen, dass die gemeinsame Ehe keine Zukunft hat und eine Scheidung die beste Alternative darstellt, können sie in Deutschland nicht ohne Weiteres die Auflösung der Ehe beantragen. Selbst wenn beide Partner dies wünschen, muss in den meisten Fällen das Trennungsjahr eingehalten werden.
Das Trennungsjahr ist eine Regulierung, die als Vorstufe der Scheidung gesehen werden kann. Während dieser Zeit soll bewiesen werden, dass die Ehe keine Zukunft hat und eine Versöhnung auszuschließen ist. Sowohl zu Beginn des Trennungsjahres als auch während seiner Zeit und mit Hinblick auf die Scheidung gibt es zahlreiche Einzelheiten zu beachten. Hier finden Sie viele wichtige Informationen auf einen Blick.
Eine vorzeitige Trennung ist auch ohne den Wunsch beider Ehepartner möglich. Erwirkt wird sie nur in Härtefällen, etwa bei schwerer Gewalt, Misshandlung der gemeinsamen Kinder oder Prostitution. Dies ist in jedem Fall eine Einzelfallentscheidung des zuständigen Gerichts.
Formalitäten während der Trennung
Die Trennung ist dann gegeben, wenn die Ehepartner ihre häusliche Gemeinschaft auflösen. Dies bedeutet, dass jeder Ehepartner im eigenen Bett schläft, für sich selbst einkauft, kocht, wäscht und andere Arbeiten eigenständig ausführt. Am einfachsten gelingt dies, wenn beide Ehepartner nicht in der gleichen Wohnung wohnen. Allerdings kann auch in einer Wohnung eine Trennung gelebt werden, wenn die obigen Punkte eingehalten werden. Der Zeitpunkt des Auseinandergehens wird am besten in einem von beiden Ehepartnern unterzeichneten Schreiben festgelegt. Sollte ein Ehepartner nicht mit der Trennung einverstanden sein, kann der andere Ehepartner die Trennung in einem Schreiben ankündigen, das am besten als Einschreiben mit Rückantwortschein versendet wird.
Während der Trennungszeit können Ehepartner bis zu drei Monate wieder in eine häusliche Gemeinschaft treten, ohne dass dies auf die Dauer Einfluss hätte. Dies ist gegeben, damit die Ehepartner die Möglichkeit für Aussöhnungsversuche haben. Sollte es keine Aussöhnung geben, beantragen die meisten Anwälte etwa vier bis sechs Monate vor dem Scheidungstermin die Scheidung. Sollte ein Ehepartner nachweisen können, dass kein Getrenntleben stattfand, kann sich die Trennungszeit auf drei Jahre verlängern. Diese Behauptung ist bei getrennten Wohnungen sehr schwer nachzuweisen, bei gemeinsamer Wohnung nur schwer zu widerlegen.
Trennungsunterhalt und Vorbereitungen für die Scheidung
In Familien, in denen beide Ehepartner unterschiedlich viel Geld verdienen, hat der weniger verdienende Partner ein Recht auf Trennungsgeld. Dieses ist vom anderen verdienenden Ehepartner zu bezahlen und beträgt üblicherweise 3/7 des Gehaltsunterschieds. Hinzu kommt Kindesunterhalt, wenn die Kinder in der Obhut des geringer verdienenden Ehepartners verbleiben. In keinem Fall kann jedoch der Selbstbehalt des zahlenden Ehepartners unterschritten werden. Trennungsgeld und Kindesunterhalt müssen eingefordert werden und sind unabhängig von Zahlungen nach der Scheidung. Der Kindesunterhalt hat Vorrang.
Ab dem Trennungszeitpunkt ändern sich eventuell die Steuerklassen der nun einzeln lebenden Personen. Dies muss dem Finanzamt angezeigt werden und kann zu Steuerrückzahlungen oder Nachzahlungen führen. Die Steuererklärung kann trotzdem von beiden getrennt lebenden Ehepartnern gemeinsam angefertigt werden.
Um sich auf den Scheidungsprozess vorzubereiten, können schon während des Trennungsjahres zahlreiche Schritte unternommen werden. So können Vermögensansprüche, das Sorgerecht für die Kinder oder die Aufteilung der Besitztümer geregelt werden. Auch eine Kontenerklärung kann in der Zeit der Trennung vorbereitet werden. Gemeinsam getroffene Beschlüsse sollten notariell beglaubigt werden.
Mit dem Begriff der Trennung wird das Auseinandergehen eines (Ehe-)Paares bezeichnet.
Von Bedeutung ist der Zeitpunkt der Trennung für die Berechnung der Zeit des Getrenntlebens innerhalb eines Scheidungsprozesses.
Die Ehegatten leben getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Die häusliche Gemeinschaft besteht auch dann nicht mehr, wenn die Ehegatten innerhalb der ehelichen Wohnung getrennt leben.
Steuerlich kann der Beginn der Trennung durch den Wechsel in die Steuerklasse IV im laufenden Jahr und Steuerklasse I im auf die Trennung folgenden Kalenderjahr dokumentiert werden. Dazu ist beim Einwohnermeldeamt eine Erklärung zum Familienstand abzugeben.
Trennungsunterhalt
Was ist Trennungsunterhalt?
Als Trennungsunterhalt wird der Unterhalt bezeichnet, der vom Zeitpunkt der Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung gezahlt wird.
Voraussetzung ist, dass die Eheleute tatsächlich getrennt leben (ggf. auch gemeinsam in der bisherigen Ehewohnung), eine Unterhaltsbedürftigkeit besteht und eine Leistungsfähigkeit des Pflichtigen besteht. Die Höhe des Trennungsunterhalts beträgt ca. 3/7 des zugrunde liegenden Einkommens, je nachdem welche Unterhaltsberechnungsmethode Anwendung findet. Auszugehen ist vom derzeitigen Einkommen des Pflichtigen, das sich durch die mit der Trennung verbundene Änderung der Steuerklasse im Nettobetrag unter Umständen erheblich verringern kann.
Der Trennungsunterhalt umfasst den Elementarunterhalt, den Vorsorgeunterhalt, den trennungsbedingten Mehrbedarf und, anders als der nacheheliche Unterhalt, die Kosten einer Krankenversicherung.
Mindestens während des ersten Trennungsjahres besteht keine Pflicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für den bisher nicht berufstätigen Unterhaltspflichtigen. Grundsätzlich nimmt mit zunehmender Trennungsdauer die Eigenverantwortlichkeit des unterhaltsbedürftigen Partners zu. Mit Ablauf des ersten Trennungsjahres besteht der Anspruch nur noch, wenn besondere Gründe vorliegen, die auch für die Gewährung des nachehelichen Unterhalts gelten, wie z.B. minderjährige Kinder, fortgeschrittenes Alter, lange Ehedauer.
Da während der Trennungszeit die Ehe noch besteht, nimmt der unterhaltsbedürftige Ehepartner an den Einkommensveränderungen des unterhaltspflichtigen Partners unverändert teil.
Der Unterhaltsberechnung sind aber nur die Einkünfte zugrunde zu legen, die dem Ehepartner tatsächlich zur Verfügung standen, d.h. den ehelichen Lebensverhältnissen entsprachen. Insbesondere bei hohen Einkünften sind bei der Berechnung die Beträge außer Acht zu lassen, die der Vermögensbildung dienten. Dies gilt aber nur solange, wie der zum Leben und der zur Vermögensbildung verbrauchte Betrag zueinander in einem ausgewogenen Verhältnis stehen Wenn z.B. durch die Sparsamkeit des Unterhaltspflichtigen die Familie einen weit unter dem Einkommen liegenden Lebensstandard pflegen musste, ist der für die Lebenshaltungskosten ausgegebene Betrag zu korrigieren und bei der Unterhaltsberechnung ist auch das zur Vermögensbildung verwendete Geld entsprechend zu berücksichtigen.
Zieht einer der Partner aus der im gemeinsamen oder alleinigen Eigentum eines Ehepartners stehenden Ehewohnung aus und bleibt der andere in ihr wohnen, so kann der die Ehewohnung verlassende Partner für den Vorteil des mietfreien Wohnens eine Nutzungsvergütung verlangen bzw. sich diese auf den Trennungsunterhalt anrechnen lassen.
Wer hat Anspruch auf Trennungsunterhalt?
Diese Frage beschäftigt viele Paare, die sich trennen. Grundsätzlich haben Ehepartner immer dann einen Anspruch auf Trennungsunterhalt, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt gelebt haben und einer von ihnen nach der Trennung nicht in der Lage ist, seinen Lebensbedarf aus eigenen Mitteln zu decken.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um den Mann oder die Frau handelt. Auch eine Ehefrau kann unter Umständen ihrem geschiedenen Ehemann Unterhalt zahlen müssen. Es kommt darauf an, wer nach der Trennung bedürftig ist und wer mehr verdient. In diesem Fall wird das sogenannte Nettoeinkommen beider Partner berücksichtigt sowie weitere Faktoren wie das Alter der Beteiligten oder eventuelle Unterhaltsverpflichtungen gegenüber gemeinsamen Kindern ausgewertet.
Wie wird die Höhe des Trennungsunterhalts berechnet?
Diese Frage ist für viele Menschen von entscheidender Bedeutung, die sich in einer Trennungssituation befinden. Die Berechnung des Trennungsunterhalts hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Einkommen und den Bedürfnissen beider Parteien.
In der Regel wird der Unterhalt auf Grundlage des sogenannten "Ehegatten-Unterhaltsrechts" berechnet. Hierbei wird das Nettoeinkommen beider Partner herangezogen und geprüft, ob einer der Partner bedürftig ist und selbst keinen angemessenen Lebensstandard aufrechterhalten kann. Ist dies der Fall, so muss der andere Partner entsprechend Unterhalt leisten. Dabei wird auch berücksichtigt, wer in der Ehe welchen Anteil an den gemeinsamen Kosten getragen hat und welche Verpflichtungen beide Partner haben (z. B. Kinderbetreuungskosten).
Eine genaue Berechnung des Trennungsunterhalts sollte immer mit einem erfahrenen Anwalt besprochen werden, um mögliche Fehler oder Ungereimtheiten zu vermeiden und eine faire Lösung zu finden.
Welche Faktoren beeinflussen die Dauer des Trennungsunterhalts?
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Berechnung des Trennungsunterhalts ist die Dauer. Wie lange muss der Unterhalt gezahlt werden? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, da die Antwort von mehreren Faktoren abhängt.
Ein entscheidender Faktor ist die Dauer der Ehe oder Partnerschaft. Je länger diese gedauert hat, desto länger muss in der Regel auch der Trennungsunterhalt gezahlt werden. Auch das Alter des unterhaltsberechtigten Ehegatten spielt eine Rolle - je älter er oder sie ist, desto länger wird der Unterhalt gezahlt werden müssen. Des Weiteren können gesundheitliche Einschränkungen oder Erwerbsunfähigkeit eine Rolle spielen und die Dauer des Trennungsunterhalts beeinflussen.
In jedem Fall sollten Sie sich individuell beraten lassen und Ihre Ansprüche auf Trennungsunterhalt prüfen lassen, um Ihre Rechte zu wahren und eine gerechte finanzielle Absicherung zu erhalten.
Kann der Antrag auf Trennungsunterhalt abgelehnt werden?
Grundsätzlich hat jeder Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner während der Trennungszeit einen gesetzlichen Anspruch auf Trennungsunterhalt und kann einen entsprechenden Antrag stellen. Allerdings kann dieser Antrag unter bestimmten Bedingungen abgelehnt werden.
Wenn zum Beispiel ein Partner nachweislich eine schwere Schuld an der Trennung trägt, kann dies dazu führen, dass der Unterhaltsanspruch entfällt. Auch wenn ein Partner bereits eine neue Beziehung eingegangen ist und dadurch finanziell besser gestellt ist, kann dies Auswirkungen auf den Unterhaltsanspruch haben.
In jedem Fall sollten Betroffene aber immer einen Antrag auf Trennungsunterhalt stellen, um sicherzustellen, dass ihre Rechte gewahrt bleiben, und sie im Falle von Ablehnung des Antrags rechtliche Schritte einleiten können.
Können sich beide Parteien auch außergerichtlich über den Unterhalt einigen?
Ein außergerichtliches Einigen über den Trennungsunterhalt ist grundsätzlich möglich. Dabei sollten beide Parteien jedoch bedenken, dass sie sich auf eine verbindliche Vereinbarung einlassen und diese entsprechend dokumentieren müssen. Es empfiehlt sich daher, die Vereinbarung schriftlich festzuhalten und gegebenenfalls von einem Anwalt prüfen zu lassen.
Auch wenn eine Einigung außergerichtlich erfolgen kann, sollte beachtet werden, dass dies unter Umständen nicht immer die beste Option darstellt. Insbesondere dann, wenn es Unklarheiten oder Meinungsverschiedenheiten gibt oder einer der Partner über keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Deckung des Unterhalts verfügt, ist es ratsam, rechtzeitig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und gegebenenfalls gerichtliche Schritte einzuleiten.
Gibt es eine Möglichkeit, den Anspruch auf Trennungsunterhalt zu verringern oder zu beenden?
Wenn sich die Umstände ändern, kann es sein, dass der Anspruch auf Trennungsunterhalt verringert oder sogar beendet werden kann. Dies ist jedoch nicht immer der Fall und hängt von den individuellen Umständen ab.
Ein Grund für eine Verringerung oder Beendigung des Unterhaltsanspruchs könnte zum Beispiel sein, wenn der empfangende Partner eine neue Beziehung eingeht oder wieder arbeiten geht und somit eigenes Einkommen generiert. Auch ein Verhalten des Unterhaltsberechtigten, das den Unterhaltspflichtigen schwerwiegend verletzt hat, kann dazu führen, dass dieser seinen Unterhaltsanspruch verliert.
Eine außergerichtliche Einigung zwischen beiden Parteien ist ebenfalls möglich und kann zu einer Verringerung oder Beendigung des Anspruchs auf Trennungsunterhalt führen. Es ist jedoch ratsam, einen Anwalt hinzuzuziehen und die rechtlichen Konsequenzen einer solchen Vereinbarung genau zu prüfen.
Welche Dokumente und Informationen sind erforderlich, um einen Antrag auf Trennungsunterhalt stellen zu können?
Um einen Antrag auf Trennungsunterhalt stellen zu können, sind bestimmte Dokumente und Informationen erforderlich. Zunächst sollte der Einkommensstatus beider Parteien bekannt sein, da er bei der Berechnung des Unterhalts eine wichtige Rolle spielt. Hierfür müssen Gehaltsbescheinigungen, Steuererklärungen oder andere Nachweise über das Einkommen vorgelegt werden.Auch die Höhe der Miete oder Hypothekenzahlungen sowie weitere laufende Kosten sollten dokumentiert werden.
Des Weiteren ist es wichtig, den Zeitpunkt der Trennung und den Grund hierfür nachzuweisen. Hierfür können beispielsweise Zeugenaussagen, polizeiliche Protokolle oder Gerichtsbeschlüsse genutzt werden.
Es empfiehlt sich zudem, sämtliche Korrespondenz zwischen beiden Parteien aufzubewahren, um gegebenenfalls Streitpunkte klären zu können. All diese Dokumente bilden die Basis für einen erfolgreichen Antrag auf Trennungsunterhalt und sollten sorgfältig vorbereitet werden.
Wie lange dauert es normalerweise, bis über den Antrag entschieden wird?
Nachdem der Antrag auf Trennungsunterhalt gestellt wurde, fragen sich viele Betroffene, wie lange es dauern wird, bis über ihn entschieden wird. Leider gibt es keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage, da die Dauer des Verfahrens von verschiedenen Faktoren abhängt.
In der Regel dauert es jedoch mehrere Wochen bis Monate, bis eine Entscheidung getroffen wird. Bei komplizierten Fällen kann das Verfahren auch mehrere Monate in Anspruch nehmen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Dauer des Verfahrens nicht nur von der Bearbeitungszeit des zuständigen Gerichts abhängt: Auch die Vollständigkeit und Richtigkeit der eingereichten Unterlagen sowie mögliche Einwände oder Einsprüche des Partners können den Prozess verzögern.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sollten Betroffene daher darauf achten, alle erforderlichen Dokumente und Informationen vollständig einzureichen und gegebenenfalls rechtzeitig auf Einwände reagieren. Insgesamt gilt: Geduld haben ist wichtig, aber auch aktiv bleiben und bei längerer Wartezeit beim zuständigen Gericht nachfragen kann helfen.
Fazit: Die wichtigsten Punkte zum Thema Trennungsunterhalt
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass Trennungsunterhalt ein komplexes Thema ist, das viele Fragen aufwirft. Es ist wichtig zu wissen, wer Anspruch darauf hat und wie die Höhe des Unterhalts berechnet wird. Auch die Dauer des Unterhalts kann von verschiedenen Faktoren abhängen.
In manchen Fällen kann der Anspruch auf Trennungsunterhalt abgelehnt werden oder es gibt Möglichkeiten, den Anspruch zu verringern oder zu beenden. Beide Parteien haben jedoch auch die Möglichkeit, sich außergerichtlich über den Unterhalt zu einigen.
Um einen Antrag auf Trennungsunterhalt stellen zu können, sind bestimmte Dokumente und Informationen erforderlich. Die Dauer, bis über den Antrag entschieden wird, kann unterschiedlich lang sein.
Insgesamt sollte jeder Fall individuell betrachtet werden und es empfiehlt sich eine rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Werden alle Aspekte berücksichtigt und sorgfältig geprüft, kann eine faire Regelung für beide Parteien gefunden werden.