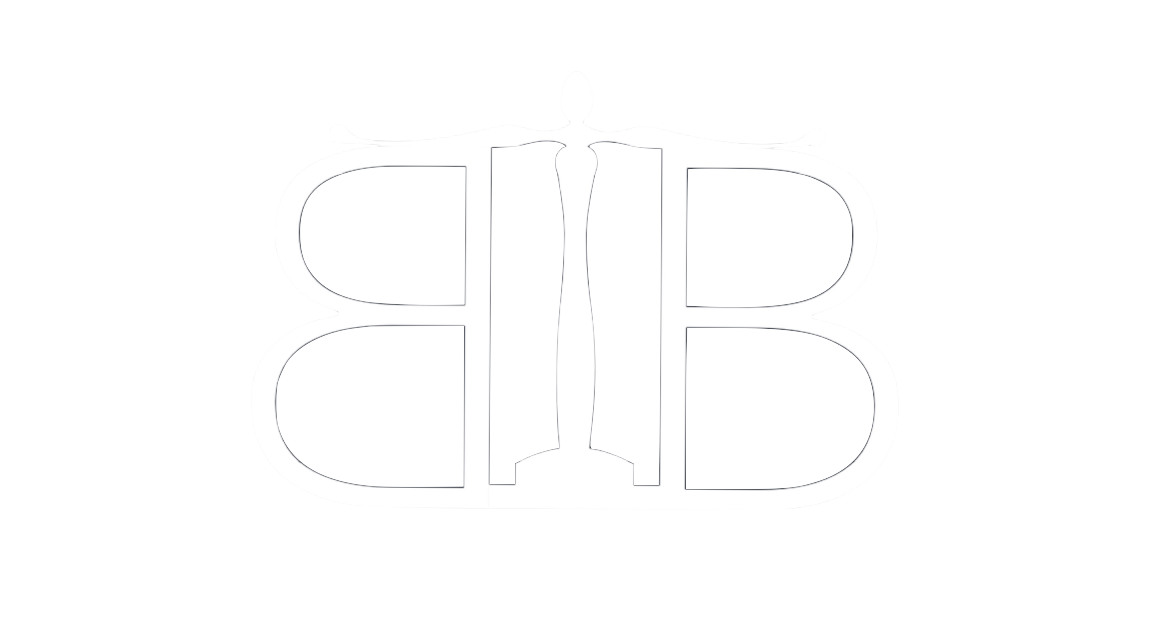Erbrecht
Arbeitnehmer und Arbeitgeber kommen tagtäglich mit einzelnen Bereichen des Arbeitsrechts in Berührung.
Die rechtliche Bedeutung ist dabei jedoch längst nicht immer klar. Besonders relevant wird dies bei Problemen im Arbeitsverhältnis. Droht eine Kündigung oder steht Mehr- bzw. Kurzarbeit an, beraten wir Sie gern umfassend.
Was ist Erbrecht?
Erbstreitigkeiten nach dem Tod eines nahen Verwandten kommen nicht selten vor. Sie werden häufig sehr emotional und unsachlich ausgetragen. Denn bei der Erstellung eines Testaments und der Verteilung des Vermögens spielen persönliches Gerechtigkeitsempfinden sowie Zuneigung eine große Rolle.
Der Tod eines Familienangehörigen oder nahen Verwandten ist außer mit großer Trauer auch oftmals mit Konflikten verbunden. In vielen Fällen kommt es deshalb bei der Verteilung des Nachlasses auch zu Streitigkeiten. Denn die Vermögenswerte der verstorbenen Person gehen dann laut Erbrecht an den einen oder an mehrere Erben über. Das passiert zwar tagtäglich, aber es sollte doch möglichst zu einer gerechten Verteilung kommen, um Streitigkeiten weitestgehend aus dem Weg zu gehen.
Holen Sie sich rechtzeitig juristische Unterstützung.
Die Anwaltskanzlei Böhm kann bereits zu Lebzeiten Erblassern helfen, den Nachlass zu regeln, wir leisten aber auch wertvolle Unterstützung in den Angelegenheiten von Erben und Erbengemeinschaften. Wir beraten kompetent und lösungsorientiert,
wenn es um folgende Themen geht:
- Pflichtteil
- Erbfolge
- Enterbung
- Gemeinschaftliches Testament
- Erbschein
- Erbverzicht
- Annahme einer Erbschaft
- Ausschlagung einer Erbschaft
Die Vorschriften und Regelungen im Erbrecht sind sehr häufig kompliziert und auch komplex. Sie sind mit 463 Paragrafen im fünften Buch des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) in den §§ 1922 bis 2385 geregelt.
Erbrecht: Die gesetzliche Regelung der Erbfolge
Wie viel ein Erbe bekommt ist abhängig vom Verwandtschaftsverhältnis:
Zuerst erben die nächsten Verwandten – das sind Ehegatten, Kinder und Enkel, erst danach kommen entfernte Verwandte.
Die näheren Verwandten schließen dabei grundsätzlich die weiter entfernten Verwandten bei der Erbfolge aus.
Das gesetzliche Erbrecht der Verwandten ist im BGB in Ordnungen aufgeteilt:
§ 1924 Erben erster Ordnung: Kinder des Erblassers und Enkelkinder
§ 1925 Erben zweiter Ordnung: Eltern des Erblassers, Geschwister, Nichten und Neffen, geschiedene Elternteile der verstorbenen Person
§ 1926 Erben dritter Ordnung:
Großeltern des Erblassers, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen
Wenn der/ die Verstorbene Kinder hatte, erben weder Eltern noch Geschwister.
War der Verstorbene kinderlos, gibt es keine Erben erster Ordnung, sodass die Eltern des Erblassers in zweiter Ordnung erben.
Auch uneheliche, adoptierte oder ungeborene Kinder haben einen Anspruch auf das Erbe.
Sollte ein Kind bereits verstorben sein, geht der Erbanspruch auf die Enkel über.
Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten
Natürlich erbt auch der überlebende Ehegatte im Rahmen des Ehegattenerbrechts gemäß § 1931 BGB. Gleiches gilt für den eingetragenen Lebenspartner, der gemäß § 10 LPartG weitestgehend dem Ehegatten gleichgestellt ist.
Grundsätzlich erhöht sich der Erbteil des Ehegatten auf die Hälfte, wenn das Ehepaar in einer Zugewinngemeinschaft gelebt hat (§§ 1931 Abs. 3, 1371 BGB) und wenn kein Ehevertrag aufgesetzt wurde.
Das Erbrecht und die Enterbung – kann man trotzdem erben?
Es ist möglich, dass Erblasser nahen Verwandten weniger vererben als dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder dass sie jemanden gänzlich enterben. Allerdings steht ihnen laut Erbrecht trotzdem von den Vermögenswerten des Verstorbenen eine Mindestbeteiligung zu. Fragen zu diesem Thema kann ein Anwalt für Erbrecht beantworten.
Pflichtteilsanspruch haben:
- Ehepartner und eingetragene Lebenspartner
- Kinder und Enkel
- Eltern kinderloser Verstorbener
Insgesamt steht ihnen 50 Prozent des gesetzlichen Erbteils zu, den sie nicht automatisch erhalten, sondern den sie einfordern müssen.
Beispiel:
Ein Verstorbener vererbt ohne Testament 60.000 Euro an seine Ehefrau und die beiden Kinder.
Dann bekommt die Ehefrau 50 Prozent (30.000 Euro),
das erste Kind und zweite Kind je 25 Prozent, also jeweils 15.000 Euro.
Wurde ein Kind enterbt, dann stehen ihm gesetzlich 50 Prozent dieses Betrags zu – also 7.500 Euro.
Begriffserklärung zum Thema Erbrecht
Annahme der Erbschaft
Willenserklärung des Erben, die ihm durch den Erbfall zugefallene Erbschaft anzunehmen.
Mit der Annahme der Erbschaft kann diese nicht mehr ausgeschlagen werden.
Der Erbe hat sechs Wochen Zeit, die Erbschaft auszuschlagen bzw. anzunehmen. Die Frist beginnt mit seiner Kenntnis vom Erbfall. Schlägt der Erbe die Erbschaft während dieser Frist nicht aus, so gilt sie als angenommen. Die Annahme nur eines Teils der Erbschaft ist unwirksam.
Die Erbschaftsannahme kann jedoch innerhalb einer weiteren Frist von sechs Wochen bei Vorliegen eines Anfechtungsgrundes angefochten werden. Anerkannt ist, dass die Überschuldung des Nachlasses eine verkehrswesentliche Eigenschaft im Sinne des § 119 Abs. 2 BGB ist.
Die Anfechtung muss zur Niederschrift des Nachlassgerichtes oder durch öffentliche Beglaubigung erfolgen. Die Erbschaft wird dadurch ausgeschlagen.
Ausschlagung einer Erbschaft
Gesetzliche Möglichkeit der Ablehnung der Erbschaft innerhalb von sechs Wochen nach Kenntnis des Erbfalls. Das Verstreichenlassen der Frist gilt als konkludente Annahme, die aber innerhalb einer weiteren Frist von sechs Wochen angefochten werden kann.
Die Frist zur Ausschlagung der Erbschaft beginnt erst, wenn der Erbe zuverlässige Kenntnis vom Anfall der Erbschaft und dem Grund seiner Berufung hat. Zuverlässige Kenntnis vom Grund der Berufung ist nicht gegeben, wenn der durch eine auslegungsbedürftige letztwillige Verfügung berufene Miterbe mit vertretbaren Gründen annimmt, er sei Alleinerbe aufgrund Gesetzes.
Die Ausschlagung ist vererblich und formbedürftig. Sie muss, ebenso wie eine Anfechtung, zur Niederschrift des Nachlassgerichts oder durch eine öffentliche Beglaubigung abgegeben werden.
Rechtsfolge ist, dass das Erbe an den nach dem Ausschlagenden Erbberechtigten fällt, es wird also fingiert, dass der Ausschlagende beim Erbfall bereits verstorben war. Dabei verliert der Ausschlagende mit der Ausschlagung grundsätzlich auch seinen Anspruch auf den Pflichtteil.
Die Ausschlagung nur eines Teils der Erbschaft ist nicht möglich. Etwas anderes gilt, wenn die verschiedenen Teile auf verschiedenen Gründen beruhen (z.B. Erbvertrag und Testament).
Die Ausschlagung kann auch nicht von einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung abhängig gemacht werden.
Berliner Testament
Das Berliner Testament – Rechtliche Absicherung für Paare
Herzlich willkommen bei unserer Anwaltskanzlei in Friedberg! Wir sind Ihre kompetenten Partner, wenn es um Angelegenheiten im Erbrecht geht.
Was ist das Berliner Testament?
Das Berliner Testament ist eine spezielle Form des gemeinschaftlichen Testaments zwischen Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern. Es ermöglicht, den überlebenden Partner nach dem Tod des ersten Partners abzusichern und gleichzeitig die gemeinsamen Kinder zu bedenken.
Die rechtliche Grundlage
Das Berliner Testament basiert auf den Regelungen des deutschen Erbrechts. Es ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert, genauer gesagt in den §§ 2265 ff. Hier werden die Voraussetzungen und Formvorschriften für ein rechtsgültiges Berliner Testament festgelegt.
Vorteile des Berliner Testaments
- Absicherung des überlebenden Partners: Durch die Regelungen im Berliner Testament erhält der überlebende Ehegatte eine umfassende Absicherung.
- Familienheim und Hausrat: Der überlebende Partner kann das gemeinsame Familienheim weiter bewohnen und auf den Hausrat zugreifen.
- Erbschaftssteuerliche Vorteile: Das Berliner Testament kann dazu beitragen, Erbschaftssteuern zu minimieren, insbesondere wenn Freibeträge ausgeschöpft sind.
Wichtige Klauseln im Berliner Testament
- Widerrufsmöglichkeiten: Das Testament kann unter bestimmten Bedingungen widerrufen oder geändert werden.
- Vor- und Nacherbschaft: Die Aufteilung des Nachlasses in Vorerbschaft und Nacherbschaft ist eine gängige Regelung im Berliner Testament.
- Pflichtteilsansprüche: Die Kinder haben trotz des Testaments Anspruch auf ihren gesetzlichen Pflichtteil. Dieser sollte bei der testamentarischen Planung berücksichtigt werden.
Fallstricke und mögliche Probleme
- Unvorhergesehene Lebensumstände: Veränderungen in der Familie, wie Scheidung oder die Geburt weiterer Kinder, können das Testament beeinflussen.
- Pflegebedürftigkeit: Wenn der überlebende Partner pflegebedürftig wird, kann dies zu finanziellen Herausforderungen führen.
- Steuerliche Aspekte: Die steuerlichen Regelungen ändern sich, deshalb ist eine regelmäßige Überprüfung des Testaments ratsam.
Rechtsberatung in Friedberg – Ihre Anlaufstelle für das Berliner Testament
Unsere Anwaltskanzlei in Friedberg ist spezialisiert auf erbrechtliche Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Berliner Testament.
Mit unserer langjährigen Erfahrung und fundierten Kenntnissen im Erbrecht stehen wir Ihnen zur Seite, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und optimal zu erfüllen. Wir nehmen uns die Zeit, Sie umfassend zu beraten und gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre Nachlassplanung zu erarbeiten.
In Friedberg und Umgebung sind wir Ihr verlässlicher Partner für alle erbrechtlichen Belange. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin in unserer Kanzlei, um mehr über das Berliner Testament und Ihre persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu erfahren. Wir freuen uns darauf, Sie in allen Fragen rund um die rechtliche Absicherung Ihrer Zukunft in Friedberg zu unterstützen.
Enterbung
Was geschieht mit dem Vermögen nach dem Todesfall des Eigentümers? Regelt der Betreffende dies nicht frühzeitig durch ein Testament, gilt die gesetzliche Regelung. Möchte man diese nicht, kann die Verteilung des Vermögens im Todesfall durch das Aufsetzen eines Testaments geregelt werden. Hierdurch können unliebsame Familienangehörige auch „enterbt“ werden.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe "Enterbung" und "Pflichtteilsentziehung" synonym gebraucht. Im engeren juristischen Sinne bezeichnet die Enterbung grundsätzlich nur die Reduzierung des Erbteils auf den Pflichtteil. Der Pflichtteil entspricht der Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
Die gesetzlichen Erben haben jedoch grundsätzlich immer einen Anspruch auf den Pflichtteil, es sei denn es liegen die in § 2333 BGB gesetzlich zulässigen Gründe für eine Enterbung vor:
- Wenn der Erbe dem Erblasser oder einer dem Erblasser nahe stehenden Person nach dem Leben trachtet,
- Wenn der Erbe sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den Erben oder einen Angehörigen schuldig macht,
- Wenn der Erbe die ihm dem Erblasser gegenüber gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht böswillig verletzt
- Wenn der Erbe wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung rechtskräftig verurteilt wird und die Teilhabe des Abkömmlings am Nachlass deshalb für den Erblasser unzumutbar ist.
Die Pflichtteilsentziehung muss in dem Testament angegeben und begründet werden.
Erbe
Mit dem Tod einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine (Erbe) oder mehrere Personen (Erbengemeinschaft) über. Dies wird auch als Gesamtrechtsnachfolge bezeichnet.
Der Erbe hat nach Kenntnisnahme der Erbschaft zwei Möglichkeiten:
- Er kann die Erbschaft annehmen.
- Er kann die Erbschaft ausschlagen.
Die Frist zur Ausschlagung der Erbschaft beträgt gemäß § 1944 BGB sechs Wochen, beginnend mit der Kenntnis seiner Erbenstellung. Mit der Annahme der Erbschaft erlischt das Recht zur Ausschlagung, jedoch kann die Annahme bei Vorliegen der Voraussetzungen noch angefochten werden.
Davon zu unterscheiden ist der Fall, dass Erben auf Konten in der Schweiz, Luxemburg etc. verborgenes Vermögen vermuten, über dessen Bankkonten sie keine Kenntnis besitzen. Es bestehen auf diese Fälle spezialisierte Unternehmensberater, die sich darauf spezialisiert haben, evtl. verborgenes Vermögen aufzuspüren.
Mit der Erbenstellung sind nachstehende Folgen verbunden:
- Haftung für Nachlassverbindlichkeiten.
- Grundsätzlicher Eintritt in bestehende Dauerschuldverhältnisse des Erblassers.
- Verpflichtung zur Zahlung von Erbschaftsteuer.
Die Erbenstellung ist durch den Erbschein bzw. bei notariellen Testamenten durch das Eröffnungsprotokoll nachgewiesen. Der Erbe ist nicht verpflichtet, sein Erbrecht durch einen Erbschein nachzuweisen. Zulässig ist auch der Nachweis in einer anderen Form. Durch die Eröffnung eines öffentlichen Testaments ist nach der Ansicht der Richter in der Regel ein ausreichender Nachweis gegeben.
Erbengemeinschaft
Erbengemeinschaft nennt man die Mehrheit von Erben eines Erblassers.
Die Erbengemeinschaft ist eine Form der Gesamthandsgemeinschaft: Bei der Erbengemeinschaft ist der Nachlass ein in der Gesamthand der Miterben stehendes Sondervermögen. Der Einzelne hat daran einen seiner Erbquote entsprechenden Anteil. Über diesen Anteil - nicht über einzelne Nachlassgegenstände - kann der Miterbe verfügen. Über den Nachlass als Ganzes können nur die Miterben gemeinschaftlich verfügen.
In den meisten Fällen ist es das Ziel der Erbengemeinschaft, das Erbe auf die einzelnen Erben zu verteilen, d.h. die Erbengemeinschaft auseinanderzusetzen. Dies ist jedoch nicht zwingend.
Daneben ist es möglich, dass der Erblasser ein Auseinandersetzungsverbot erteilt. Dies Verbot kann jedoch nur längstens für einen Zeitraum von 30 Jahren erteilt werden.
Der Begriff Auseinandersetzung bezeichnet die Aufteilung des Erbes auf die Mitglieder der Erbengemeinschaft bei vorheriger Begleichung der Nachlassverbindlichkeiten.
Der Erblasser selbst kann die Auseinandersetzung durch eine sogenannte Teilungsanordnung vorgeben bzw. ein Vorausvermächtnis anordnen.
Die Erbauseinandersetzung kann wie folgt durchgeführt bzw. erzwungen werden:
- Testamentsvollstreckung
- Erbauseinandersetzungsklage
- Übertragung aller Erbteile auf eine Person
- Vermittlung durch das Nachlassgericht
Ein Erbe kann die Auseinandersetzung (noch) nicht verlangen, wenn
- die Erbteile wegen der noch zu erwartenden Geburt eines Miterben unbestimmt sind,
- die Erbteile wegen der Entscheidung über einen Antrag über die Annahme als Kind, die Aufhebung des Annahmeverhältnisses oder die Anerkennung einer vom Erblasser errichteten Stiftung als rechtsfähig noch unbestimmt sind,
- die Auseinandersetzung durch den Erblasser ausgeschlossen wurde,
- die Voraussetzungen der Aufschubsberechtigung der Auseinandersetzung durch einen Miterben vorliegen.
Erbfolge
Die Erbschaft geht im Wege der Universalsukzession auf die Erben nach einer gesetzlichen Rangfolge über. Für den Anspruch der Erben ist entscheidend, welchen Ordnungsrang sie in der Erbfolge haben.
- Erben erster Ordnung: Ehegatte, Kinder
- Erben zweiter Ordnung: Eltern, Kinder der Eltern
- Erben dritter Ordnung: Großeltern, Kinder der Großeltern
- Erben vierter Ordnung: Urgroßeltern, Kinder der Urgroßeltern
Die Erbfolge kann vom Erblasser willkürlich bestimmt werden, allerdings steht bestimmten Erben ein Pflichtteil zu.
Erbschein
Der Erbschein ist ein auf Antrag vom Nachlassgericht ausgestelltes Zeugnis über den Inhalt und den Umfang des Erbrechts des Erbscheininhabers.
Ist der Erbschein ausgestellt, besteht für den Inhalt die Vermutung der Richtigkeit, die Ausstellung eines Erbscheins ändert jedoch nicht die materielle Rechtslage.
Gutgläubige Dritte werden in ihrem guten Glauben an das Erbrecht des Erben geschützt, solange ein wirksamer Erbschein ausgestellt ist.
Es wird zwischen folgenden Formen von Erbscheinen differenziert:
- Alleinerbschein
- Gemeinschaftlicher Erbschein (bei Erbenmehrheit)
- Teilerbschein (bei Erbenmehrheit, auf Antrag eines Erben)
- Gruppenerbschein (zusammengefügte mehrere Teilerbscheine)
- Hoffolgezeugnis (im Bereich der Hoferbfolge)
Nicht nach jedem Erbfall muss ein Erbschein beantragt werden. Der Nachweis der Erbenstellung durch den Erbschein kann in den folgenden Fällen entfallen:
- Der Nachlass befindet sich bereits im Besitz des Erben.
- Der Erblasser hat eine postmortale Vollmacht erteilt.
- Es wurde ein öffentliches Testament errichtet (BGH 07.06.2005 - XI ZR 311/04).
- Es wurde ein Testamentsvollstrecker eingesetzt.
Sofern eine Bank zum Nachweis der Erbenstellung trotz der Errichtung eines öffentlichen Testaments die Vorlage eines Erbscheins verlangt, ist dies zulässig, wenn das Rechtsverhältnis den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken unterliegt.
Stellt sich die Unrichtigkeit der dem Erbschein zugrunde liegenden Tatsachen heraus, so hat das Nachlassgericht den Erbschein einzuziehen. Ist dies nur mit einer Zeitverzögerung möglich, so hat es den Erbschein für kraftlos zu erklären. Der wirkliche Erbe hat gegen den vermeintlichen Erben einen Anspruch auf Herausgabe des Erbscheins an das Nachlassgericht.
Der Nacherbe hat vor dem Nacherbfall kein Antragsrecht auf die Erteilung eines Erbscheins.
Erbvertrag
Der Erbvertrag ist eine vertragliche Verfügung von Todes wegen.
Es wird zwischen einseitigen und zweiseitigen Erbverträgen unterschieden:
- Bei einem einseitigen Erbvertrag verpflichtet sich nur der Erblasser zu einer Verfügung von Todes wegen. Unerheblich ist, ob sich auch die andere Vertragspartei zu einer Leistung unter Lebenden verpflichtet, z.B. der Pflege des Erblassers.
- Bei einem zweiseitigen Erbvertrag verpflichten sich beide Vertragsparteien zu Verfügungen zu Todes wegen. Der Erbvertrag wird als gegenseitig bezeichnet, wenn sich die Vertragsparteien dabei gegenseitig bedenken.
Inhalt des Erbvertrages kann eine Erbeinsetzung, ein Vermächtnis oder eine Auflage sein.
Der Erblasser ist zu seinen Lebzeiten nicht gehindert, über sein Vermögen zu verfügen.
Der Erbe hat nur nach dem Tod des Erblassers die Möglichkeit, einen Bereicherungsanspruch gegen den Beschenkten geltend zu machen.
Voraussetzung ist aber, dass der Erblasser die Schenkung in einer den Erben beeinträchtigenden Absicht vorgenommen hat. Diese ist gegeben, wenn der Erblasser an der Schenkung kein lebzeitiges Eigeninteresse hatte.
Von dem überlebenden Ehegatten vorgenommene Verfügungen an Dritte, bei denen es sich nicht um die Schlusserben (d.h. in den meisten Fällen die Kinder) handelt, können grundsätzlich, von den oben genannten Verfügungsbeschränkungen abgesehen, nicht verhindert werden. Diese können erst nach dem Tod des (letzten) Erblassers in Beeinträchtigungsabsicht vorgenommene Schenkungen zurückfordern.
Feststellungs- oder Auskunftsklagen, mit denen der Erbanwärter bereits zu Lebzeiten des Erblassers die Höhe der Schenkung bzw. seinen Rückforderungsanspruch feststellen möchte, sind nach der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte Koblenz und München unzulässig. Auch die Sicherung des Anspruchs durch die Einleitung eines Arrests oder einer einstweiligen Verfügung wird von der Rechtsprechung abgelehnt, es sei denn, es besteht eine schuldrechtlich wirkende Verfügungsunterlassungsverpflichtung.
Anders als das Gemeinschaftliche Testament oder das Berliner Testament kann ein Erbvertrag zwischen allen natürlichen Personen geschlossen werden, es können auch mehr als zwei Personen beteiligt sein.
Der Erbvertrag bedarf der notariellen Beurkundung.
Der Erbvertrag wird in amtlicher Verwahrung aufbewahrt, bei dem beurkundenden Notar.
Erbverzicht
Vertraglich vereinbarter Verzicht des/der gesetzlichen Erben auf den gesetzlichen Erbteil.
Der Erbverzicht ist von der Erbausschlagung zu unterscheiden: Diese ist kein Vertrag, sondern eine erst nach dem Eintreten des Erbschaftsfalls erklärte Ablehnung der Erbschaft.
Der Erbverzicht erstreckt sich grundsätzlich auch auf die Abkömmlinge des Verzichtenden, nicht jedoch, wenn es sich um den Ehepartner des Erblassers handelt. Den gemeinsamen Kindern steht ein eigenes Erbrecht zu. Die in den sonstigen Fällen erfolgende automatische Erstreckung auf die Abkömmlinge kann aber vertraglich ausgeschlossen werden.
Der Erbverzicht ist notariell zu beglaubigen. Er kann unter einer Bedingung (z.B. der Zahlung eines bestimmten Geldbetrages) geschlossen werden.
Verzichtet jemand zu Gunsten eines anderen auf sein gesetzliches Erbrecht, so wird nach dem Gesetz vermutet, dass der Erbverzicht unter der Bedingung geschlossen wurde, dass die andere Person tatsächlich Erbe wird. Verzichtet ein Abkömmling auf sein gesetzliches Erbe, so wird vermutet, dass der Verzicht nur zugunsten der anderen Abkömmlinge und des Ehegatten des Erblassers gelten solle.
In der Praxis werden Erbverzichtsverträge oftmals bei einer Unternehmensnachfolge mit den nicht das Unternehmen übernehmenden Kindern bei gleichzeitiger Zahlung einer Abfindung geschlossen. Ändern sich die dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen, kann eine Erhöhung der ursprünglichen Abfindung durch Vertragsanpassung nach den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Betracht kommen.
Gemeinschaftliches Testament
Unsere erfahrene Anwaltskanzlei in Friedberg unterstützt Sie beim Verfassen und Überarbeiten gemeinschaftlicher Testamente.
Das Verfassen eines Testaments ist eine wichtige Angelegenheit, die sorgfältige Überlegung erfordert. Ein gemeinschaftliches Testament bietet oft eine effiziente Lösung für Ehepaare oder Lebenspartner, die ihre Vermögensverhältnisse regeln möchten. In Friedberg steht Ihnen unsere renommierte Anwaltskanzlei mit langjähriger Erfahrung im Erbrecht zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche in Ihrem gemeinschaftlichen Testament angemessen berücksichtigt werden.
Warum ein gemeinschaftliches Testament?
Die Entscheidung für ein gemeinschaftliches Testament kann verschiedene Gründe haben, darunter:
- Absicherung des Partners: Durch ein gemeinschaftliches Testament können Partner sicherstellen, dass der überlebende Partner nach dem Tod des anderen angemessen versorgt ist.
- Vermögensnachfolge planen: Die Aufteilung des Vermögens nach dem Tod wird im gemeinschaftlichen Testament festgelegt, um Streitigkeiten unter den Erben zu vermeiden.
- Steuerliche Vorteile nutzen: Ein gut gestaltetes gemeinschaftliches Testament kann steuerliche Vorteile bieten, die bei individuellen Testamenten möglicherweise nicht erreichbar sind.
Welche Vorteile bietet ein gemeinschaftliches Testament gegenüber individuellen Testamenten?
Ein gemeinschaftliches Testament bietet mehrere Vorteile gegenüber individuellen Testamenten. Erstens ermöglicht es Ehepartnern oder Lebenspartnern, gemeinsam ihre Vermögensverhältnisse zu regeln. Dies schafft Klarheit und verhindert mögliche Erbstreitigkeiten. Zweitens können steuerliche Vorteile genutzt werden, die bei individuellen Testamenten möglicherweise nicht erreicht werden können. Drittens bietet ein gemeinschaftliches Testament die Möglichkeit, den überlebenden Partner angemessen abzusichern.
Fachkundige Beratung für individuelle Bedürfnisse
Unsere Anwaltskanzlei verfügt über ein Team von spezialisierten Anwälten für Erbrecht, die Ihnen eine individuelle Beratung bieten. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre persönliche Situation zu verstehen, um ein gemeinschaftliches Testament zu erstellen, das Ihre Wünsche und Bedürfnisse genau widerspiegelt.
Leistungen im Überblick
Wir bieten umfassende Unterstützung in Bezug auf gemeinschaftliche Testamente, einschließlich:
- Testamentserstellung: Gemeinsam mit unseren Anwälten können Sie ein Testament erstellen, das alle relevanten Punkte berücksichtigt und rechtlich einwandfrei ist.
- Testamentsänderungen: Falls sich Ihre Lebensumstände ändern, helfen wir Ihnen dabei, Ihr gemeinschaftliches Testament entsprechend anzupassen.
- Rechtliche Beratung: Unsere Anwälte stehen Ihnen für alle Fragen rund um das Erbrecht und gemeinschaftliche Testamente zur Verfügung.
Wichtige Überlegungen beim Verfassen eines gemeinschaftlichen Testaments
Bevor Sie Ihr gemeinschaftliches Testament erstellen, sollten Sie die folgenden Punkte sorgfältig durchdenken:
- Gegenseitige Verfügungen: Legen Sie fest, welche Verfügungen sich die Partner gegenseitig zusichern.
- Erben und Vermächtnisse: Definieren Sie klar, wer welche Vermögenswerte erbt, und berücksichtigen Sie mögliche Vermächtnisse.
- Pflichtteilsansprüche: Bedenken Sie die gesetzlichen Pflichtteilsansprüche und treffen Sie entsprechende Regelungen.
- Notwendige Formvorschriften: Achten Sie darauf, dass Ihr gemeinschaftliches Testament den gesetzlichen Formvorschriften entspricht, um seine Gültigkeit sicherzustellen.
Gemeinschaftliches Testament: Unterstützung vom Anwalt in Friedberg
Ein gemeinschaftliches Testament ist eine wichtige rechtliche Dokumentation, die sorgfältige Überlegung erfordert. Unsere Anwaltskanzlei in Friedberg steht Ihnen mit umfassender rechtlicher Expertise zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihr gemeinschaftliches Testament Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung und verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung im Erbrecht.
Gemeinschaftliches Testament: Ihre rechtliche Absicherung für die Zukunft
Als erfahrene Anwaltskanzlei in Friedberg stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema "Gemeinschaftliches Testament" kompetent zur Seite. Ein gemeinschaftliches Testament ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Personen, die ihren letzten Willen gemeinsam festlegen möchten. Es bietet eine Möglichkeit, das Vermögen nach dem Ableben gerecht zu verteilen und bestimmte Regelungen für den Erbfall zu treffen. Hier erfahren Sie alles Wichtige über gemeinschaftliche Testamente und wie wir Ihnen dabei helfen können, Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche rechtlich umzusetzen.
Was ist ein gemeinschaftliches Testament?
Ein gemeinschaftliches Testament, auch als "Berliner Testament" bekannt, ist eine Form des Testaments, die von Ehepartnern oder eingetragenen Lebenspartnern gemeinsam errichtet wird. Es ermöglicht, dass sich beide Partner gegenseitig als Alleinerben einsetzen und festlegen können, wer nach dem Tod des zweiten Partners erben soll. Dabei werden oft auch Regelungen getroffen, wie beispielsweise die Weitervererbung des Vermögens an gemeinsame Kinder oder andere Personen.
Vorteile eines gemeinschaftlichen Testaments
- Klare Regelungen: Ein gemeinschaftliches Testament bietet die Möglichkeit, klare und eindeutige Regelungen für den Erbfall festzulegen.
- Partnerabsicherung: Durch die gegenseitige Einsetzung als Alleinerben wird der überlebende Partner rechtlich abgesichert.
- Vermeidung von Streitigkeiten: Ein gut durchdachtes gemeinschaftliches Testament kann dazu beitragen, Streitigkeiten unter den Erben zu vermeiden und den Erbfall reibungslos abzuwickeln.
Wichtige Punkte beim Verfassen eines gemeinschaftlichen Testaments
Beim Verfassen eines gemeinschaftlichen Testaments gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
- Klare Formulierungen: Es ist wichtig, dass das Testament eindeutig formuliert ist, um Missverständnisse oder Interpretationsschwierigkeiten zu vermeiden.
- Beidseitige Zustimmung: Beide Partner müssen mit dem Inhalt des Testaments einverstanden sein und es gemeinsam errichten.
- Beratung durch einen Anwalt: Es empfiehlt sich, sich vor dem Verfassen eines gemeinschaftlichen Testaments von einem erfahrenen Anwalt für Erbrecht beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Aspekte berücksichtigt werden.
Pflichtteil
Bestimmte nahe Angehörige des Erblassers haben grundsätzlich einen Anspruch auf einen Teil des Erbes, es sei denn, die Voraussetzungen einer Pflichtteilsentziehung (Enterbung) sind gegeben.
Pflichtteilsberechtigt sind folgende Personen:
- Grundsätzlich immer pflichtteilsberechtigt sind die Kinder des Erblassers (auch Adoptivkinder, aber keine Pflegekinder oder Stiefkinder).
- Ebenfalls immer pflichtteilsberechtigt sind der Ehegatte bzw. der Lebenspartner des Erblassers.
- Pflichtteilsberechtigt sein können die Eltern des Erblassers und entferntere Abkömmlinge, sofern nicht ein Abkömmling, der sie von der gesetzlichen Erbfolge verdrängen würde, pflichtteilsberechtigt ist oder das Erbe annimmt.
- Der Pflichtteil entspricht in der Höhe der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils zur Zeit des Erbfalls. Der Pflichtteilsberechtigte hat keinen Anspruch auf Nachlassobjekte, es handelt sich um einen reinen Zahlungsanspruch. Bei der Berechnung des gesetzlichen Erbteils sind auch die Personen mitzuzählen, die wegen Enterbung, Ausschlagung oder Erbunwürdigkeit nicht erben. Die Aufzählung ist abschließend.
Der Anspruch geht nur auf einen finanziellen Ausgleich. Der Pflichtteilsberechtigte hat einen Auskunftsanspruch gegen den Erben. Wäre der Erbe ebenfalls pflichtteilsberechtigt, kann er einen Ausgleich insoweit verweigern, als dass er seinen eigenen Pflichtteil einsetzen müsste.
Eine Enterbung ist daher in den sonstigen Fällen nur hinsichtlich der den Pflichtteil überschreitenden Erbmasse möglich. Der Pflichtteil kann dem Erben gegen seinen Willen nicht entzogen werden, es kann jedoch im Rahmen eines Erbvertrages bzw. eines reinen Pflichtteilsverzichtvertrages auf ihn verzichtet werden.
Die Voraussetzungen sind, dass der Pflichtteilsberechtigte durch Testament von der Erbfolge ausgeschlossen wurde und Gründe für eine Pflichtteilsentziehung nicht bestehen.
Testament
Mit der Errichtung eines Testaments kann der Erblasser über die Verteilung seines Vermögens unter Beachtung der Vorgaben des Pflichtteils bestimmen, der Eintritt der gesetzlichen Erbfolge wird ausgeschlossen.
Das Testament gehört zu den Verfügungen von Todes wegen, die sowohl die verschiedenen Formen der Testamente als auch Erbverträge erfassen.
Voraussetzungen einer wirksamen Testamentserrichtung sind:
- Höchstpersönlichkeit (Stellvertretung unzulässig)
- Testierfähigkeit des Erblassers
- Testierwille
- Einhaltung der Formvorschriften
- keine Nichtigkeitsgründe
Je nach der Art der Errichtung werden öffentliche und private Testamente sowie Sonderformen unterschieden:
- Das öffentliche Testament wird vor einem Notar errichtet und notariell beurkundet.
- Das private Testament wird eigenhändig von dem Erblasser verfasst.
Von einem allgemeinen Testament abweichende Sonderformen sind:
- das Gemeinschaftliche Testament
- das Berliner Testament
- die außerordentlichen Testamente:
- das Nottestament
- das Drei-Zeugen-Testament
- das Seetestament
Eine der Voraussetzungen der wirksamen Errichtung eines Testaments ist die Testierfähigkeit des Erblassers. Die Testierfähigkeit entspricht im Wesentlichen der Geschäftsfähigkeit: Gemäß § 2229 Abs. 4 BGB i.V.m. § 104 BGB kann ein Geschäftsunfähiger nicht wirksam ein Testament errichten.
Auch eine unter Betreuung gestellte Person ist testierfähig, sofern sie nicht geschäftsunfähig ist.
Die Wirksamkeit eines eigenhändigen Testaments erfordert gemäß § 2247 BGB die Einhaltung folgender Formvorgaben:
- das eigenhändige und handschriftliche Verfassen des gesamten Textes
- die eigenhändige Unterschrift des Erblassers
- die Angabe des Ortes und des Datums der Testamentserrichtung (Fehlen der Angaben führt jedoch nicht zur Unwirksamkeit)
Grundsätzlich ist der Erblasser aufgrund der Testierfreiheit frei in der Gestaltung seiner letztwilligen Verfügungen. Begrenzt wird die Testierfreiheit durch das Pflichtteilsrecht, die Sittenwidrigkeit oder gesetzliche Vorgaben.